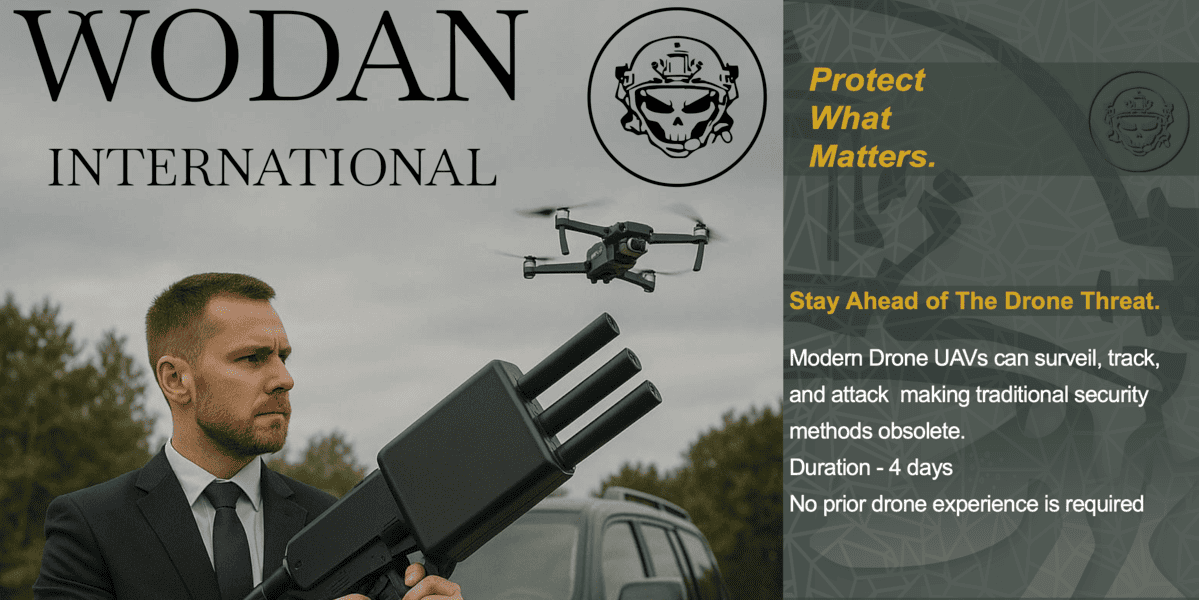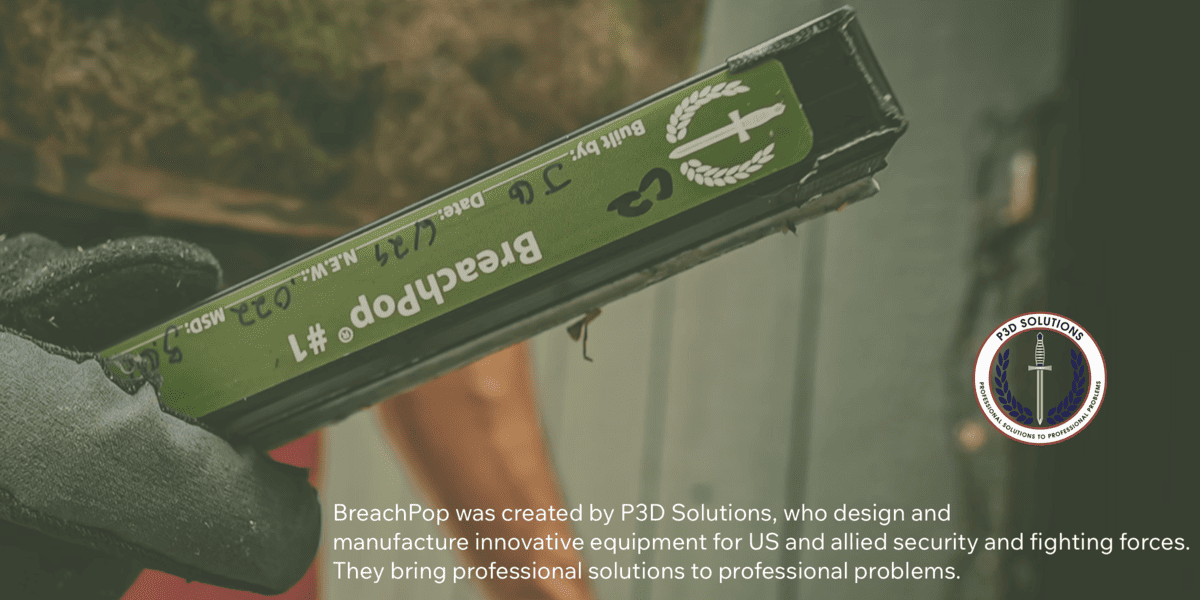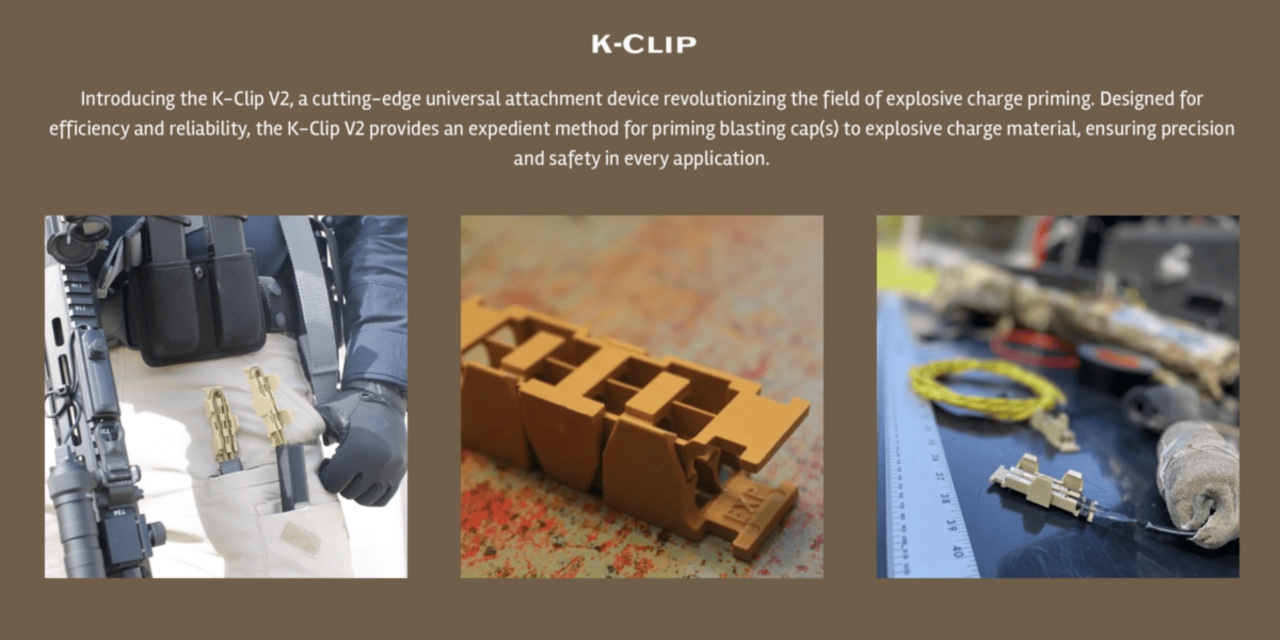Thomas Lojek
Interview mit Kris Paronto
Effektive taktische Entscheidungsfindung in dynamischen Situationen
Kris Paronto ist ein ehemaliger Army Ranger des 2nd Battalion, 75th Ranger Regiment, sowie ein privater Sicherheitsberater.
Er gehörte zum CIA-Annex-Sicherheitsteam, das auf den Terroranschlag auf die Special Mission der USA in Bengasi, Libyen, am 11. September 2012 reagierte.
Dabei trug er dazu bei, mehr als 20 Menschenleben zu retten, während er und sein Team über mehr als 13 Stunden hinweg Terroristen vom CIA-Annex zurückdrängten.
Die Geschichte von Kris und seinen Kameraden wird im Buch 13 Hours von Mitchell Zuckoff erzählt. 2016 wurde sie von Michael Bay unter dem Titel 13 Hours verfilmt.
Heute ist Kris Paronto New-York-Times-Bestsellerautor, ein gefragter Redner, und er bildet weiterhin ausgewählte Gruppen von Operatoren über sein Unternehmen Battleline Tactical aus.
Erfahrungen innerhalb und außerhalb von Einsatzgebieten sammeln
Thomas Lojek: Kris, du bist weiterhin sehr aktiv im Trainingssektor. Kannst du erklären, was du derzeit machst und worauf sich dein Schwerpunkt in deinem Trainingsgeschäft richtet?
Kris Paronto: Ich diente beim 2nd Battalion, 75th Ranger Regiment und später als Private Security Contractor für verschiedene Sicherheitsunternehmen wie Blackwater Security und SOC sowie als Direktbeauftragter der CIA – lange bevor der Angriff in Bengasi stattfand.
Ich verbrachte viel Zeit in wunderschönen Ländern wie Afghanistan, Irak, Jemen und Libyen.
Und das sind wirklich wunderschöne Länder.
Es ist eine wilde, raue, kompromisslose Schönheit – aber dennoch eine Schönheit.
Ich arbeitete über zehn Jahre im Ausland und sammelte umfangreiche Erfahrungen innerhalb und außerhalb von Kampfzonen.
Zwischen den Einsätzen kehrte ich in die USA zurück und arbeitete als Lead Instructor im High Threat Protection OGA-Programm von Blackwater.
Dadurch konnte ich die Taktiken, die wir in den USA lehrten, in realen Operationen anwenden.
Sehr schnell wurde mir klar, dass Taktiken, die in kontrollierten Trainingsumgebungen funktionieren, in unkontrollierten Einsatzumgebungen scheitern können.
Ich lernte während dieser Jahre enorm viel – von anderen Operatoren und Instruktoren ebenso wie in meiner eigenen Rolle als Instructor, sowohl zwischen Einsätzen als auch bei Missionen selbst, bei denen wir afghanische Partnerkräfte in Schießen, Objektschutz und taktischen Grundlagen ausbilden mussten.
Ich gründete Battleline Tactical im Jahr 2017, ungefähr vier Jahre nachdem ich das GRS-Programm der CIA verlassen hatte.
Ich war einige Zeit nicht mehr aktiv im Trainingssektor tätig gewesen und spürte den Drang, wieder in die Ausbildung einzusteigen.
Battleline Tactical entstand aus dem Wunsch, Wissen weiterzugeben, das mir selbst vermittelt worden war – und um wieder Teil der Firearms-Community zu werden.
Anfangs waren wir nur zu zweit: ein ehemaliger GRS-Kamerad, Dave Benton, und ich. Dave ist inzwischen ausgeschieden, aber das Team ist gewachsen – unter anderem durch den ehemaligen Army Ranger des 1st Battalion Ben Morgan, den früheren MMA-Fighter und mehrfachen Black-Belt-Träger Benny Glossop sowie den ehemaligen Army MP Jeremy Mitchell als Lead- und Assistant Instructor.
Wir arbeiten zudem regelmäßig mit herausragenden Instruktoren zusammen und führen gemeinsame Firearms-Kurse durch – mit Daniel Lombard von Davad Defense, den Mauer-Brüdern von Treadproof Training, Paul Braun von der Maxim Defense Academy und Brad Dillion samt seinem Team vom Red River Gun Range.
Momentan führen wir vor allem mobile Trainings durch.
Früher suchten wir landesweit nach Schießständen für unsere Kurse, aber inzwischen nutzen wir primär die Einrichtungen von Davad Defense in Crete (Illinois) und Lake Geneva (Wisconsin), Defender Outdoors in Fort Worth (Texas), Treadproof Training in Nunnelly (Tennessee) und Red River Range in Shreveport (Louisiana).

Alles und jeder ist ständig in Bewegung
Thomas Lojek: Erzähl mir etwas über das Training.
Kris Paronto: Wir bieten ein breites Spektrum an Kursen an – von Stressfire über Basic Pistol bis Basic Rifle.
Alle Kurse haben ihren Wert, aber meine Favoriten sind weiterhin die Einsteigerklassen.
Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie schnell das Selbstvertrauen eines neuen Schützen wächst.
Während meiner Zeit bei Blackwater reisten wir zu vielen Trainingsorten im Land, und ich hatte oft das Gefühl, dass dort zu viel herumgestanden und zu viel geredet wurde.
Es gab zu viel über persönliche Geschichten, zu viele langatmige PowerPoint-Slides – oft mit dem Ziel, Glaubwürdigkeit zu beweisen, statt echte Lessons Learned weiterzugeben.
Die Instruktoren jedoch, von denen ich am meisten lernte, brachten uns kurz hinein, erklärten Erwartungen und Curriculum – und dann ging es sofort auf den Schießstand.
Sie demonstrierten die Aufgaben und ließen uns diese unmittelbar ausführen – mit situativen Korrekturen.
Bei Battleline wollten wir genau an diesen Ansatz anknüpfen.
Natürlich müssen wir erklären, was wir tun, und manchmal bedeutet das, dass man sich „auf die Kiste stellt“, um zu erläutern, warum eine Taktik funktioniert oder nicht. Aber es darf niemals in Selbstdarstellung abgleiten.
Als Schüler oder Instructor wollte ich nie Geschichten hören, die nur dem Ego eines Ausbilders dienen.
Wenn die mentale Präsenz im Training sinkt, sinkt die Qualität des Trainings – und wir versagen dem Teilnehmer gegenüber.
Deshalb haben wir unser Trainingsmodell angepasst.
Ich griff dafür auf meine Erfahrungen aus dem Varsity-Sport zurück – Football, Basketball, Baseball, Track – und später NCAA Football.
Firearms-Training ist letztlich nichts anderes als ein Sport – und ein Instructor ist nichts anderes als ein Coach.
Coaches lehren, führen, motivieren, korrigieren und holen das Beste aus ihren Spielern heraus.
Football-Training ist ständig in Bewegung – von Station zu Station, mit minimalem unnötigem Gerede.
Genau dieses Prinzip haben wir übernommen.
Unsere Klassen sind oft groß – 30 Leute und mehr. Deshalb teilen wir sie in Gruppen à 10 Personen, jede mit einem klaren Kursfokus: Combatives, Pistole oder Karabiner.
Nach zwei Stunden rotieren alle Gruppen.
Du hast zwei Stunden – fokussiere dich, korrigiere dich selbst, lerne, arbeite, habe Spaß.
Wir machen kaum Pausen – das kommt aus meiner Ranger- und Football-Zeit.
Das Ergebnis: hochdynamische, fokussierte und motivierende Kurse für Anfänger wie Profis.
Alles und jeder ist ständig in Bewegung.
Ausbilden. Demonstrieren. Trainieren. Nicht totreden.

Das ist der Tod vieler Kurse: zu viel Gerede
Thomas Lojek: Wie reagieren die Teilnehmer auf deinen dynamischeren Stil?
Kris Paronto: Die Reaktionen sind großartig. Nach dem Kurs sind die Leute erschöpft, aber sie haben ein echtes Gefühl von Leistung.
Menschen lieben Herausforderungen – selbst wenn sie glauben, dass sie das nicht tun.
Wir stellen sie vor Herausforderungen.
Wir pushen sie genau so weit, dass sie erkennen, dass sie etwas erreicht haben – und dadurch wächst ihr Selbstvertrauen.
Es gibt wenig Leerlauf, wenig Herumstehen, denn das ist für mich der Tod vieler Kurse: zu viel Gerede.
Dadurch verlieren wir die Aufmerksamkeit der Teilnehmer.
Bring die Leute auf die Linie, demonstriere, trainiere, bewerte, korrigiere, demonstriere erneut, trainiere weiter – und immer wieder.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mehr lernen, indem wir Fehler machen, verstehen, warum wir sie gemacht haben, sie korrigieren – statt indem wir alles von Anfang an richtig machen.
Wir lernen durch Tun. Lernen. Wieder Tun.
Teilnehmer sollen wertvolle Lektionen aus dem ziehen, was sie selbst im Kurs tun – nicht aus Geschichten über die Heldentaten des Instruktors.
Ersetze nicht ihre eigene Motivation durch eine gute Erzählung über dich selbst – außer die Geschichte erklärt konkret, warum eine Technik oder Taktik funktioniert oder nicht funktioniert.
Fordere sie zum Handeln heraus. Zum Bewegen. Zum Entscheiden. Zum Scheitern. Zum Übertreffen.
Natürlich müssen wir die Sicherheit gewährleisten, vor allem wenn wir den Teilnehmern Raum geben, Fehler zu machen.
Sicherheit ist einer der wichtigsten Faktoren in Battleline-Kursen.
Wenn die Sicherheit steht, lassen wir sie machen. Fehler machen. Lernen. Mit ihren eigenen Händen, ihren eigenen Augen, ihrem eigenen Kopf – während sie denken und sich bewegen.
Ich nenne das dynamisches Lernen.
Es ist die effektivste Form des Lernens.

Wir sind keine Instruktoren … wir sind Coaches und Mentoren
Thomas Lojek: Wie bist du zu diesem Trainingsstil gekommen? Hat das mit deiner Militärkarriere und deinen Jahren als Contractor zu tun?
Kris Paronto: Es kommt direkt aus dem Football.
Mein Vater war Division-1-Football-Coach des BYU-Teams, das 1984 die National Championship gewann.
Ich wuchs mit Football-Legenden auf – LaVell Edwards, Mike Holmgren, Steve Young, Jim McMahon, Robbie Bosco.
Ich sah, wie Head Coach Edwards als Mentor agierte – und wie Assistenten wie mein Vater, Holmgren und Norm Chow Spieler entwickelten, die später NFL-Stars wurden.
Das war Mentoring, nicht einfach „Instruieren“.
Es ging darum, das Beste aus dem Spieler herauszuholen.
Diese Mentoring-Kultur prägte mich – zusammen mit meinen eigenen Jahren als Spieler auf dem Feld.
Nach einer aufrichtigen Selbstanalyse, wurde mir klar:
Als Firearms-Instructors sind wir keine Instruktoren.
Wir sind Coaches und Mentoren.
Wir sind da, um zu motivieren, zu entwickeln, anzuleiten.
Der Wechsel von „Instruktor“ zu „Coach“ hält das Ego aus dem Training heraus.
Es geht um die Teilnehmer, nicht um uns.
Es geht um ihre Verbesserung – nicht um unsere Geschichten oder unseren Status.
Es gibt extrem viel Arroganz im Bereich Firearms-Training.
Das ist unangenehm, aber wahr.
Diese Arroganz schreckt neue Schützen ab – und hindert selbst Profis daran, sich weiterzuentwickeln. Selbst im professionellen und operativen Bereich schleicht sich dieses „taktische Ego“ ein und richtet Schaden an.
Am Ende ersetzt der Rang oder der Name die grundlegendste Wahrheit eines Warriors:
Es gibt immer Raum für Verbesserung.
Wir machen es anders.
Wir bekommen viele neue Menschen in unsere Kurse, die zu echten Enthusiasten werden – und das erfüllt uns mit Demut.
Wir haben auch viele erfahrene Profis – LEOs, Militärveteranen – die unser Trainingsumfeld respektieren. Sie bringen eigene Lessons Learned ein, und wir fördern das.
Anfänger gehen mit Selbstvertrauen, Profis gehen mit Respekt.
Und genau das wollen wir.
Wir wollen jemanden lächeln sehen, weil er etwas gelernt oder einen wertvollen Beitrag geleistet hat.

Der beste Weg, es richtig zu machen, ist, mehrere Wege zu lernen
Thomas Lojek: Dein Trainingsstil klingt sehr freiheitsorientiert. Aber Combat Training hat doch oft dogmatische Aspekte. Wie passt das zusammen?
Kris Paronto: Combat Training ist wie ein Kitbag: Wir wollen so viel wie möglich hineinpacken – damit wir es herausziehen können, wenn wir es brauchen.
Um das zu können, musst du viele Wege lernen, um eine Aufgabe auf verschiedene Arten bewältigen zu können.
Dogma existiert, ja. Es gibt oft eine Methode, die effizienter ist als andere.
Aber realistische Variablen können diese „eine beste Methode“ völlig wertlos machen.
Was, wenn du deine Hand verlierst?
Was, wenn du stürzt und dir den Arm brichst?
Was, wenn du nur einen Finger benutzen kannst?
Wie bekämpfst du dann eine Bedrohung?
Ich habe am meisten gelernt, wenn etwas Unerwartetes passierte – wenn Karma den Plan zerstörte.
Meine Football-Coaches gaben mir Regeln – und sagten:
„Spiel. Probier aus. Mach Fehler. Lerne daraus. Erkenne, was funktioniert.“
Ich habe Operators gesehen, die enorme Erfahrung haben – und trotzdem in einer neuen Situation blockieren, weil sie nicht auf Variablen vorbereitet waren.
Deshalb lehre ich:
Lerne viele Wege.
Trainiere viele Wege.
Mach sie alle zur Gewohnheit.
Instinkt existiert nicht.
Gewohnheit existiert.
Marksmanship, Waffenpräsentation, Bewegungsmuster – alles wird durch Wiederholung zur Gewohnheit.
Unter Stress handeln wir nicht instinktiv.
Wir handeln gemäß unserem höchsten Niveau erlernter Gewohnheiten.
Du kannst nicht eine einzige Methode lernen und glauben, sie funktioniert in jeder Lage.
Das ist eine Garantie für Misserfolg.
Du musst viele Wege lernen – und im entscheidenden Moment den richtigen aus dem Kitbag ziehen.

Es wird immer Variablen geben, die alles verändern
Thomas Lojek: Wie bringst du Teilnehmern bei, dass sie eines Tages sowohl Freiheit als auch Dogma benötigen?
Kris Paronto: Indem wir viele Methoden lehren und verschiedene Lösungswege trainieren.
In Combat-Situationen müssen wir für den Moment trainieren, in dem eine Bedrohung direkt vor uns steht. Aber es wird immer Variablen geben, die „den einen Weg“, den wir kennen, unbrauchbar machen.
Deshalb ist es entscheidend, auch sekundäre und tertiäre Alternativen zu haben.
Was ist, wenn du deine Hand verlierst?
Was ist, wenn du von einer Mauer fällst und dir den Arm brichst?
Was ist, wenn dir nur noch ein Finger zur Verfügung steht?
Wie bekämpfst du dann eine Bedrohung?
Ich habe am meisten gelernt, wenn „der Affenschlüssel in die Maschine geworfen wurde“ – wenn die Stripperin namens Karma auftauchte und den bestausgearbeiteten Plan zerstörte.
Schon als Jugendlicher lernte ich von meinen Football-Coaches:
„Spiele. Probiere aus. Finde heraus, was funktioniert. Lerne aus Fehlern. Wenn die Situation wiederkommt, weißt du, was zu tun ist.“
Ich habe Operatoren mit enormer Erfahrung scheitern sehen, weil sie nicht auf eine unvorhergesehene Variable vorbereitet waren.
Karma kam mit Wucht – und es herrschte Chaos.
Mir ist das auch passiert. Ich hatte Glück, aus manchen Situationen mit allen Fingern und Zehen herauszukommen. Danach folgte die Selbstanalyse – oder das verpflichtende AAR – sowohl beim 2/75 als auch später bei GRS.
Ich lernte auf die harte Tour, oft vor meinen Peers, was ich falsch gemacht hatte und was korrigiert werden musste.
Eine grundlegende Lektion, die ich Menschen immer mitgebe:
Auch wenn du scheiterst – mach weiter.
Hör nicht auf. Schlag dich nicht selbst nieder.
Lerne sofort daraus.
Die Kugel ist downrange – wir holen sie nicht zurück.
Wir können nur neu ausrichten, neu zielen und erneut feuern.
Sehr dogmatische Instruktoren können in solchen Momenten Schaden anrichten. Ich habe es selbst erlebt – als Teilnehmer und als Instructor.
Vor allem bei Room-Clearing- oder Force-on-Force-Szenarien:
Ein Teilnehmer macht einen Fehler – und bleibt stehen. Friert ein. Bricht ab.
Manche schauen dann zu mir und fragen mit den Augen:
„Sag etwas. Was soll ich tun?“
Und ich sage:
„Ich weiß nicht. Was denkst du, solltest du tun?“
Ich mache mich nicht lustig über sie.
Ich will, dass sie denken.
In einer dynamischen Situation ist das Schlimmste, was du tun kannst, keine Entscheidung zu treffen.
Das wurde mir als junger Ranger eingebrannt.
Wir hören nicht auf.
Wir bewegen uns weiter.
Wir trainieren durch den Fehler hindurch.
… außer der Fehler ist so massiv, dass mein Squad Leader eine sofortige Korrektur verhängt. Dann heißt es: Ja, das muss sein. Und weiter.
Ich habe genug Erfahrung gesammelt, um zu wissen:
Wenn alles schiefgeht, dürfen wir nicht aufgeben.
Wir müssen weiterkämpfen. Weitergehen.
Ich habe viele Fehler gemacht – aber ich bin immer weitergegangen.
Das ist das Ranger-Mindset – und ich bin dankbar, dass es ein Teil meiner Persönlichkeit wurde.
Wir hören nie auf.
Die bestgelegten Pläne gehen oft schief, aber wenn wir nicht stoppen, kommen wir meistens durch.
Die „Ich-höre-auf-und-warte-auf-Anweisungen“-Mentalität ist gefährlich. Sie wächst in Trainingsumgebungen, die zu dogmatisch sind.
Ein flexibler Trainingsansatz dagegen lehrt Menschen, weiterzumachen – egal was passiert.
Du führst die Mission zu Ende – und erst danach evaluieren wir, was im Kopf des Teilnehmers vor sich ging.
Ich habe das intensiv jeden Montag im Football gelernt – nach einem Samstagsspiel, wenn wir Film schauten und jede Szene sezierten.
Nichts ist demütigender, als seine eigenen Fehler vor dem gesamten Team in Zeitlupe zu sehen.
Dasselbe gab es später beim 2/75 – nach Missionen wie nach Trainingseinsätzen.
Es lehrte mich, konstruktive Kritik anzunehmen und korrekt weiterzugeben – ohne jemanden zu erniedrigen.

Die Ranger-Instruktoren setzten uns einem enormen Stresslevel aus
Thomas Lojek: Welche Rolle spielen Angst und die Angst vor dem Scheitern im Combat Training?
Kris Paronto: Angst als Werkzeug, als Element des Trainings – einschließlich der Angst vor dem Scheitern – muss sehr genau verstanden werden, insbesondere dort, wo sie ihren Platz hat und wo nicht.
Ich denke, Angst und die Angst zu versagen sind notwendige Elemente, wenn wir ein Auswahlverfahren durchlaufen oder für eine Special Ops Unit oder eine paramilitärische Organisation der höchsten Kategorie antreten.
Wir brauchen dieses Gefühl der Angst vor dem Scheitern, um ein gewisses Maß an Stress zu erzeugen.
Es sorgt dafür, dass sich die Leistungsstärksten durchsetzen und diejenigen aussortiert werden, die nicht bereit sind.
Normalerweise reicht die Angst, aus der Einheit geworfen zu werden oder ein DNR zu erhalten, völlig aus.
Die Angst, aus der Einheit ausgeschlossen zu werden oder meinen Job zu verlieren, falls ich die Auswahl oder das Tryout nicht bestehen würde, erzeugte in mir eine Form von Angst, die stärker war als jedes Anschreien oder jede Einschüchterungstaktik.
Als ich jedoch in die PMC-Welt wechselte, war ich gut vorbereitet – denn genau so ist das 75th Ranger Regiment.
Es gibt das standardisierte Auswahlverfahren, das früher R.I.P. hieß und heute R.A.S.P., um in das 75th Ranger Regiment aufgenommen zu werden. Und dann gibt es natürlich die Ranger School, sofern man das Glück hat, nicht vorher als RFS aus der Einheit entfernt zu werden, bevor man überhaupt die Chance bekommt, den Ranger Tab zu verdienen.
Aber auch im täglichen Dienst beim 75th Ranger Regiment werden wir kontinuierlich bewertet.
Es gibt keine Pause, und wenn man einen Fehler macht, gibt es zunächst eine Reihe kreativer, körperlich äußerst fordernder Strafen.
Und das ist notwendig.
Es erinnert uns jeden Tag daran, wer wirklich dort sein will, und sortiert diejenigen aus, die es nicht wollen.
Denn wenn jemand den täglichen Belastungen nicht standhalten kann – und ich spreche hier nicht einmal von R.I.P. oder der Ranger School, die für sich genommen eine eigene Form der Hölle darstellt – dann wird er definitiv aussteigen, wenn die Situation wirklich kritisch wird.
Aber ich halte dies nicht für sinnvoll bei offenen Kursen für zivile Teilnehmer.
Ein Teilnehmer in einem Battleline-Kurs wird nichts lernen, wenn ich ihm ins Gesicht schreie, ihn dazu bringe, die Füße hochzunehmen und Liegestütze zu machen, bis die Arme versagen, oder seine Optik über die gesamte Schießbahn werfe, nur weil sie vor Kursbeginn nicht festgezogen war.
(Das ist tatsächlich an einem bekannten Trainingsstandort passiert. Es war völlig unnötig und unangebracht.)
Ja, in Trainingsumgebungen, in denen es darum geht, „Kannst du diese Belastung aushalten?“, also bei Vorbereitungen für Elite-Teams oder Spec-Ops-Einheiten, kann das sinnvoll sein.
Ich selbst habe durch Angst gelernt – sowohl während meiner Zeit als Ranger im 75th als auch später beim Einstieg in das GRS-Programm. Aber nicht durch die Angst vor einem Instruktor, der glaubte, mich mit seinem „Thousand-Yard-Stare“ einzuschüchtern.
Die Angst, von der ich gelernt habe, war meine eigene, selbst erzeugte Angst – die Angst zu versagen, die Angst vor dem Unbekannten und die Angst, meinen eigenen Standards nicht gerecht zu werden.
Die Ranger School war das beste Beispiel für diese Art von Angst.
Die Ranger-Instruktoren setzten uns einem enormen Stresslevel aus – aber das war gut, denn es zwang mich, schnell zu lernen.
Wir hatten nicht den Luxus, dass uns eine Aufgabe mehrfach erklärt oder gezeigt wurde.
Die Aufgabe, die Bedingungen und der Standard wurden vorgegeben, und wenn wir Glück hatten, wurde die Aufgabe einmal demonstriert. Danach hieß es:
„Es steht in deinem Ranger Handbook. Such es dir raus, Ranger!“
Die Angst, in der Ranger School Verantwortung übernehmen zu müssen, kombiniert mit der Angst zu versagen, als „tabless bitch“ zum 2/75 zurückzukehren und die damit verbundene Demütigung vor allen anderen mittragen zu müssen, ließ mich verstehen, dass Lernkurven zwar steil sind, aber bewältigt werden können.
Und genau diese Erfahrung half mir später, ein besserer GRS-Operator zu werden.
Aber diese Form von Angst ist für offene Kurse nicht notwendig.
Kein Teilnehmer zahlt Geld, um eine Fähigkeit zu erlernen, nur um dann vor anderen gedemütigt zu werden.
Wir als Coaches und Instructors müssen wissen, wann es an der Zeit ist, ein wenig Stress einzubauen – und wann es an der Zeit ist, zu mentorieren und Coach zu sein.
Ich bin dankbar, dass ich beide Arten des Lernens und Lehrens verstehen und anwenden kann.
Es ist ein weiteres Set an Fähigkeiten, das mir beigebracht wurde und das ich in meinen Kitbag packen kann, um es bei Bedarf einzusetzen.
Wir wollen unsere Teilnehmer stärken – nicht demontieren
Thomas Lojek: Setzt du diese Prinzipien in deinen Battleline-Kursen ein?
Kris Paronto: Ja. Bei Battleline ist es eines unserer Kernprinzipien, unsere Teilnehmer aufzubauen – nicht sie niederzureißen.
Wir wissen, dass es verschiedene Wege gibt, dieselben Aufgaben zu erfüllen, und dass nicht jeder Mensch gleich lernt.
Wir vermitteln Fundamentals – sie sind das Herzstück jeder Coaching-Struktur.
Aber wir wissen auch: Variablen können ein Fundamental beeinflussen.
Dann müssen wir flexibel coachen.
Es gibt Instruktoren, die Teilnehmer erniedrigen – manchmal bis zur Demütigung. Das überschreitet eine Grenze.
Ein guter Coach würde das nie tun.
Ein guter Coach findet immer einen Weg zu lehren, zu mentorieren und die richtige Vorgehensweise geduldig zu demonstrieren.
Teilnehmer buchen einen Kurs, um Skills zu lernen – nicht, um vor anderen bloßgestellt zu werden.
Wir alle lernen unterschiedlich, aber am Ende wollen wir dieselbe Sache:
Die Fähigkeiten erwerben, die uns Sicherheit geben.
Als Coaches müssen wir den Weg finden, auf dem der Teilnehmer das erreicht.
Wir schreien Battleline-Teilnehmer nicht an. Wir reden nicht herab.
Wir mentorieren. Wir beantworten Fragen. Wir motivieren zum Lernen.
Teilnehmer wollen ein gewisses Maß an Druck – aber nicht Demütigung.
Bei Battleline sind wir Coaches.
Unser Prinzip „Wir können immer besser werden“ stammt aus meiner Football-Zeit.
Wir können ehrlich miteinander sein, wenn wir Fehler machen – aber wir nutzen Fehler als Lernpunkte, nicht als Waffen.
Das schließt an die Dogma-vs.-Flexibilität-Frage an:
Der richtige Coaching-Stil hängt davon ab, wo der Teilnehmer auf seiner Lernkurve steht.
Wenn du einen Erstschützen anschreist, als wäre er im Ranger Battalion, verlierst du ihn – und oft eine ganze Community von neuen Schützen.
Wir verlieren neue Schützen in der 2A-Community durch unnötige Großspurigkeit und Einschüchterung.
Meine Empfehlung an jeden Instructor:
Wenn dein Kurs Schreien beinhaltet, wenn extrem hoher Stress Teil der Methode ist – kommuniziere es vorher klar.
Manche werden es lieben – und sofort buchen.
Andere bleiben weg – und so muss es sein.
In offenen Kursen müssen wir Umgebungen schaffen, in denen alle lernen können – und wir müssen sie korrekt bewerben.
Ich selbst habe einige Kurse, die auf hohem Stress basieren.
Aber der Stress entsteht dort durch körperliche Intensität – nicht durch Anschreien.
Der Stress kommt durch Muskelermüdung, Atmung, Anstrengung.
Das ist nachhaltiger, effektiver – und respektvoller.
Nach zwei Tagen fühlen sich die Teilnehmer gefordert – und stolz auf das, was sie geleistet haben.
Offene Kurse sollten nicht einschüchternd sein.
Spezialisierte Kurse für Special-Operations-Teams oder große SWAT-Einheiten benötigen dagegen Stresslevel, die ihre Führer definieren.
Alle dazwischen sollten die Trainings finden, auf die sie am besten reagieren.
Lerne von jedem – und irgendwann findest du den Coach, der für dich funktioniert.